Werkverzeichnis
 Druckversion
Druckversion
| Verlag | ||
|---|---|---|

Abendsegen (2009)
Für drei Alphörner

Augenzwinkernd wird heute das Alphorn nicht selten als das „Handy des Mittelalters“ bezeichnet. In der Tat, diese Naturinstrumente aus Holz dienten viele Jahrhunderte den Menschen hauptsächlich zur Nachrichtenübermittlung. Alphörner gibt es nicht nur in den Berggebieten und da wieder vorzugsweise in der Schweiz. Verwandte Formen dieses Naturinstruments werden auch in den Pyrenäen, in Skandinavien, Estland, Polen, Rumänien, ja sogar in Kirgisistan geblasen. Während die Alphörner in früheren Zeiten fast ausschließlich als „Verständigungsmittel“ dienten, werden sie heute auch „konzertant“ eingesetzt. Alphörner sind geradezu prädestiniert eine beeindruckende Abendstimmung zu erzeugen. Der „Abendsegen“ von Gottfried Veit ist für drei Alphörner gleicher Stimmung geschrieben. Formal entspricht er der kleinen dreiteiligen Liedform. Musikalisch zeichnet er sich vor allem durch eine andächtige Grundstimmung aus. Der „Abendsegen“ von Gottfried Veit wurde von der „EUREGIO Alphorngruppe Via Salina“ unter der Leitung von Paul Knoll auf der CD „Das Allgäuer Alphorn und seine Geschichte“ (Mobile Records, Helmut Sonntag) akustisch festgehalten. Verlag: Alphorn-Center Verlag Schwierigkeitsgrad: Leicht Spieldauer: 1`15`` |
Alphorn-Center Verlag | |

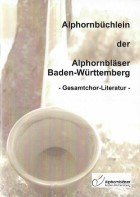
Es sind schon sehr viele Jahre vergangen, seit man das Alphorn ausschließlich mit der Schweiz in Verbindung brachte. Mittlerweile wird dieses urige Naturinstrument nicht nur im gesamten bayerischen Sprachraum, sondern auch in Baden-Württemberg und weit darüber hinaus mit Begeisterung geblasen. Da die zahlreichen Alphornbläser schon länger den Wunsch verspürten sich zusammen zu schließen, entstanden zwischenzeitlich mancherorts Verbandsgründungen. Der „Alphornverband Baden-Württemberg“ veröffentlichte vor kurzem ein Alphornbüchlein mit 23 ausgewählten Kompositionen für das Zusammenspiel von Alphornbläsern. Die Musikstücke dieser Sammlung werden von der Verbandsleitung vor allem für die Darbietung von sogenannten „Gesamtchören“ empfohlen. Eines dieser Stücke nennt sich ABENDSEGEN und stammt aus der Feder von Gottfried Veit. Es trägt die Vortragsbezeichnung „Mit Andacht“ und entspricht der kleinen dreiteiligen Liedform A-B-A. Seine Dreistimmigkeit ist so angelegt, dass es eventuell auch als Duo dargeboten werden kann, da die dritte Stimme lediglich die beiden harmonietragenden Hauptfunktionen Tonika und Dominante dazusteuert. Verlag: Alphornbläser Baden-Württemberg Schwierigkeitsgrad: Leicht Spieldauer: 1´35´´ |
Alphornbläser Baden-Württemberg | |

Alphorn-Ruf (2001)
Für drei Alphörner
Dem Geschäftsführer des Allgäuer Zeitungsverlages GmbH Markus Brehm gewidmet 
Das Alphorn dürfte eines der ältesten Blasinstrumente sein. Diese langgestreckte „Holztrompete“ wurde früher aus einem einzigen gehöhlten - in der richtigen Krümmung gewachsenen - Tannenstamm hergestellt. Das Rohr ist in den meisten Fällen gerade und zeigt am unteren Ende nach oben. Seine Länge kann bis zu vier Metern betragen. Die Stimmung der Alphörner ist unterschiedlich: am verbreitetsten sind jene Instrumente in der F-Stimmung. Seit einigen Jahrzehnten fand dieses eher primitive Hirteninstrument sogar Einzug in die Kunstmusik. Wie mehrere der Alphornstücke von Gottfried Veit, so hat auch sein dreistimmiger „Alphorn-Ruf“ einen Widmungsträger. Es ist dies der Geschäftsführer des Allgäuer Zeitungsverlages Markus Brehm. Das Musikstück selbst beginnt mit einem einstimmigen Signal in freiem Vortrag. Daran schließt sich ein Bläserruf im „Tutti“ an, der mit „Fröhlich“ überschrieben ist. Verlag: Allgäuer Zeitungsverlag Schwierigkeitsgrad: Mittel Spieldauer: 1´00´´ |
Allgäuer Zeitungsverlag | |

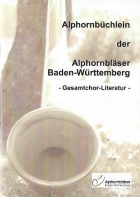
Es sind schon sehr viele Jahre vergangen, seit man das Alphorn ausschließlich mit der Schweiz in Verbindung brachte. Mittlerweile wird dieses urige Naturinstrument nicht nur im gesamten bayerischen Sprachraum, sondern auch in Baden-Württemberg und weit darüber hinaus mit Begeisterung geblasen. Da die zahlreichen Alphornbläser schon länger den Wunsch verspürten sich zusammen zu schließen, entstanden zwischenzeitlich mancherorts Verbandsgründungen. Der „Alphornverband Baden-Württemberg“ veröffentlichte vor kurzem ein Alphornbüchlein mit 23 ausgewählten Kompositionen für das Zusammenspiel von Alphornbläsern. Die Musikstücke dieser Sammlung werden von der Verbandsleitung vor allem für die Darbietung von sogenannten „Gesamtchören“ empfohlen. Eines dieser Stücke nennt sich ALPHORN-RUF und stammt aus der Feder von Gottfried Veit. Es ist zweiteilig und für drei Alphörner gleicher Stimmung konzipiert. Während im ersten Teil („Frei im Vortrag“) ein achttaktiges Solo erklingt, ist der zweite Teil („Fröhlich“) von bewegten Achtelfiguren der ersten- und zweiten Stimme gekennzeichnet. Die dritte Stimme übernimmt hier die Bassfunktionen von Tonika und Dominante. Verlag: Alphornbläser Baden-Württemberg Schwierigkeitsgrad: Leicht Spieldauer: 1´20´´ |
Alphornbläser Baden-Württemberg | |

Alphorn-Tag (2001)
Für vier Alphörner
Erschienen für vier Alphörner und Blasorchester beim Verlag RUNDEL 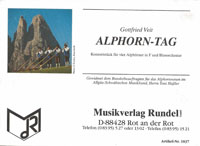
Das Alphorn dürfte eines der ältesten Blasinstrumente sein. Diese langgestreckte „Holztrompete“ wurde früher aus einem einzigen gehöhlten - in der richtigen Krümmung gewachsenen - Tannenstamm hergestellt. Das Rohr ist in den meisten Fällen gerade und zeigt am unteren Ende nach oben. Seine Länge kann bis zu vier Metern betragen. Die Stimmung der Alphörner ist unterschiedlich: am verbreitetsten sind jene Instrumente in der F-Stimmung. Seit einigen Jahrzehnten fand dieses eher primitive Hirteninstrument sogar Einzug in die Kunstmusik. Die Komposition „Alphorn-Tag“ von Gottfried Veit liegt hier in einer Spezialfassung vor. Diese vierstimmige Alphornmusik entstammt dem gleichnamigen Konzertstück für vier Alphörner in F und Blasorchester, das 1996 beim Musikverlag RUNDEL in Druck erschienen ist. Der hier veröffentlichte unbegleitete Hauptteil („Tranquillo“) dieser Komposition eignet sich hervorragend auch gesondert dargeboten zu werden. Verlag: Allgäuer Zeitungsverlag Schwierigkeitsgrad: Mittel Spieldauer: 1´15´´ |
Allgäuer Zeitungsverlag | |

Am Wilden Kaiser (2009)
Für vier Alphörner

Augenzwinkernd wird heute das Alphorn nicht selten als das „Handy des Mittelalters“ bezeichnet. In der Tat, diese Naturinstrumente aus Holz dienten viele Jahrhunderte den Menschen hauptsächlich zur Nachrichtenübermittlung. Alphörner gibt es nicht nur in den Berggebieten und da wieder vorzugsweise in der Schweiz. Verwandte Formen dieses Naturinstruments werden auch in den Pyrenäen, in Skandinavien, Estland, Polen, Rumänien, ja sogar in Kirgisistan geblasen. Während die Alphörner in früheren Zeiten fast ausschließlich als „Verständigungsmittel“ dienten, werden sie heute auch „konzertant“ eingesetzt. Das Stück „Am Wilden Kaiser“ ist für vier Alphörner gleicher Stimmung angelegt. Gottfried Veit widmete es Herrn Markus Hechenberger und seiner Alphorngruppe. Nach einem kurzen Ruf im „Allegro“ folgt der eigentliche Hauptteil im „Adagio“, der durch eine viertaktige „Coda“ („wie ein Echo“) abgeschlossen wird. Verlag: Alphorn-Center Verlag Schwierigkeitsgrad: Mittel Spieldauer: 1´25´´ |
Alphorn-Center Verlag | |

Ancilla Domini-Messe (2012)
Missa Brevis für gemischten Chor und Orgel
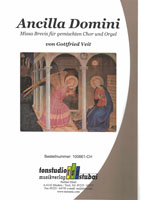
Aus der Heiligen Schrift wissen wir, dass Maria, die Gottesmutter, nicht nur als "Himmelskönigin", sondern auch als "Magd des Herrn" verehrt wird. Als ihr in der Stadt Nazareth der Engel Gabriel erschien, sagte sie: "Siehe, ich bin die Magd des Herrn" ("Ecce Ancilla Domini"). Lukas 1,38. Die hier vorliegende Missa Brevis für gemischten Chor und Orgel trägt den Namen "Ancilla Domini". Sie wurde in Form und Inhalt bewusst schlicht gehalten, um vor allem leistungsschwächeren Chören einen guten Dienst zu erweisen. Damit die Einstudierung dieser Messvertonung eine augenscheinliche Erleichterung erfährt, besteht das "Kyrie" und das "Agnus Dei" aus nahezu demselben Tonmaterial. Während das "Kyrie" in G-Dur notiert ist, steht das "Agnus Dei" in der gleichnamigen Molltonart, endet aber im aufgelichteten Dur. Im Verlauf des "Gloria" erklingt der einleitende Hauptteil gleich mehrere Male mit unterschiedlicher Textunterlegung. Auch dies erleichtert die Einstudierung. Auf die Vertonung des besonders textreichen "Credo" wurde gänzlich verzichtet. Das "Sanctus" beginnt zwar feierlich, hat aber ab dem "Pleni sunt coeli" einen sehr leichtfüßigen Charakter. So ist dieser schlichten "Ancilla Domini-Messe" nur noch eine ihr gebührende Verbreitung und den Ausführenden viel Freude bei der Darbietung derselben zu wünschen. Verlag: Tss Musikverlag Schwierigkeitsgrad: Leicht Spieldauer: 10´20´´ |
Tss Musikverlag | |

Andreas Hofer Ouvertüre (2008)
Von Albert Lortzing/Gottfried Veit
Für je 2 Ob., Klar., Hr., Fg., Flöte und Kontrafagott 
Die bekannteste Heldengestalt Tirols und weit darüber hinaus ist Andreas Hofer. Dass es mehrere "Andreas Hofer-Märsche" gibt, dürfte allgemein bekannt sein. Dass aber gleich neun Komponisten einen ihrer Märsche nach dieser bedeutenden Tiroler Persönlichkeit benannt haben, ist sogar Insidern ein Novum. Mehr oder weniger unbekannt ist auch die Tatsache, dass Albert Lortzing (geb. am 23. Oktober 1801 in Berlin – gest. am 21. Januar 1851 ebenda) ein Singspiel schrieb, das ebenfalls den Titel "Andreas Hofer" trägt. Dieses Singspiel entstand im Jahre 1832 und wurde am 14. April 1887 in Mainz uraufgeführt. Es trägt die Opuszahl LoWV 27 und ist einaktig. Das Textbuch dazu verfasste Albert Lortzing selbst. Natürlich hat sich das Singspiel "Andreas Hofer", schon wegen seines patriotischen Inhalts, auf den Spielplänen der Opernhäuser nicht gehalten. Da es sich um eine Gelegenheitskomposition Lortzings handelt, blieb auch sein Notenmaterial bis heute im Manuskript. Lediglich die Ouvertüre erschien 1940 bei Breitkopf & Härtel - mit der Verlagsnummer 3525 - in Druck. Da dieses umfangreiche Vorspiel unzählige hübsche melodische Einfälle aufweist und zudem formal einem mustergültigen "Sonatenhauptsatz" entspricht ist es lohnenswert, sich damit zu beschäftigen. Die hier vorliegende Bearbeitung der "Andreas Hofer-Ouvertüre" von Albert Lortzing ist wie geschaffen für die Besetzung eines großen Bläserensembles. Gottfried Veit entschied sich für folgende instrumentale Zusammensetzung: je zwei Oboen, Klarinetten, Hörner, Fagotte, eine Flöte und ein Kontrafagott. Übrigens, das Kontrafagott kann ohne Bedenken durch einen Kontrabass ersetzt werden. Verlag: Tss Musikverlag Schwierigkeitsgrad: Mittel Schwer/Schwer |
Tss Musikverlag | |

Ave Maria (2010)
Für vierstimmigen gemischten Chor

Das "Ave Maria" ("Gegrüßet seist Du, Maria") ist der lateinische Beginn des allgemein bekannten Grundgebetes der katholischen Kirche. Es gehört nach dem "Vaterunser" zu den meistgesprochenen Gebeten der Christenheit und ist auch Bestandteil des "Angelus" sowie des "Rosenkranzes". Ave Maria-Vertonungen schufen Komponisten aller Epochen. Die hier vorliegende Vertonung von Gottfried Veit weist einen eher schlichten Charakter auf und soll "Mit Innigkeit" vorgetragen werden. Sie beginnt nur mit den Frauenstimmen, aber schon ab dem siebten Takt stimmen die Tenöre und die Bässe in den ruhigen Gesang ein. Obwohl sich dieses "Ave Maria" einmal bis ins "ff" steigert, klingt es wieder – wie zu Beginn – im "mp" aus. Widmungsträger dieser marianischen Komposition von Gottfried Veit ist P. Paul Maria Sigl, der geistliche Leiter der FAMILIE MARIENS. Verlag: Tss Musikverlag Schwierigkeitsgrad: Mittel Schwer Spieldauer: 2´20´´ |
Tss Musikverlag | |

Bergsommer am Fellhorn (2001)
Für vier Alphörner
Herrn Augustin Kröll von seinen Alphornfreunden gewidmet 
Das Alphorn dürfte eines der ältesten Blasinstrumente sein. Diese langgestreckte „Holztrompete“ wurde früher aus einem einzigen gehöhlten - in der richtigen Krümmung gewachsenen - Tannenstamm hergestellt. Das Rohr ist in den meisten Fällen gerade und zeigt am unteren Ende nach oben. Seine Länge kann bis zu vier Metern betragen. Die Stimmung der Alphörner ist unterschiedlich: am verbreitetsten sind jene Instrumente in der F-Stimmung. Seit einigen Jahrzehnten fand dieses eher primitive Hirteninstrument sogar Einzug in die Kunstmusik. Das vierstimmige Alphornstück „Bergsommer am Fellhorn“ bestellten die Alphornfreunde von August Kröll beim Südtiroler Komponisten Gottfried Veit. Dieses dreiteilige Bläserstück erlebte an einem traumhaften Sommertag am Allgäuer Fellhorn seine Uraufführung. Als dieses Musikstück aus der Taufe gehoben wurde waren, neben August Kröll, zahlreiche Freunde der Alphornmusik anwesend. Unter ihnen befand sich auch der sogenannte „Allgäuer Alphornpapst“ Toni Hassler. Verlag: Allgäuer Zeitungsverlag Schwierigkeitsgrad: Mittel Spieldauer: 1´10´´ |
Allgäuer Zeitungsverlag | |

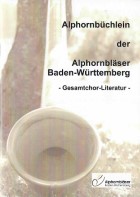
Es sind schon sehr viele Jahre vergangen, seit man das Alphorn ausschließlich mit der Schweiz in Verbindung brachte. Mittlerweile wird dieses urige Naturinstrument nicht nur im gesamten bayerischen Sprachraum, sondern auch in Baden-Württemberg und weit darüber hinaus mit Begeisterung geblasen. Da die zahlreichen Alphornbläser schon länger den Wunsch verspürten sich zusammen zu schließen, entstanden zwischenzeitlich mancherorts Verbandsgründungen. Der „Alphornverband Baden-Württemberg“ veröffentlichte vor kurzem ein Alphornbüchlein mit 23 ausgewählten Kompositionen für das Zusammenspiel von Alphornbläsern. Die Musikstücke dieser Sammlung werden von der Verbandsleitung vor allem für die Darbietung von sogenannten „Gesamtchören“ empfohlen. Eines dieser Stücke nennt sich BERGSOMMER AM FELLHORN und stammt aus der Feder von Gottfried Veit. Es ist für vier Alphörner gleicher Stimmung geschrieben und besteht aus einer viertaktigen Einleitung, einem achttaktigen Hauptteil, einem viertaktigen Mittelteil dem die ersten vier Takte des Hauptteiles folgen, der mit einem zweitaktigen „Echo“ im mit „ritardando“ folgt. Sein andächtiger und zurückhaltender Grundcharakter wird im Mittelteil von kräftigen und akzentuierten Klängen unterbrochen. Verlag: Alphornbläser Baden-Württemberg Schwierigkeitsgrad: Mittel/Schwer Spieldauer: 1´40´´ |
Alphornbläser Baden-Württemberg | |

Cäcilien-Messe (2019)
Plenar-Messe für gemischten Chor, Kantor, Volksgesang und Blasorchester (oder Orgel)
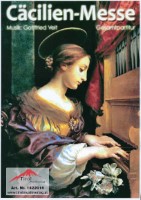
Die heilige Cäcilia (gestorben um 230 in Rom) war – der Legende nach – eine vornehme Römerin, die im dritten Jahrhundert nach Christi lebte und für den christlichen Glauben den Märtyrertod starb. Seit dem 13. Jahrhundert wird sie häufig mit Musikinstrumenten dargestellt. Ihre herausragenden Attribute sind die Orgel, die Violine, das Schwert (als Attribut des Martyriums) und die Rose. Erst seit dem 15. Jahrhundert wird sie als Patronin der Musik, insbesondere der Kirchenmusik, verehrt. Eine ihr zu Ehren errichtete Kirche wurde an einem 22. November eingeweiht. Daher wird dieser Tag allgemein als der „Cäcilientag“ gefeiert. Der Leichnam der heiligen Cäcilia wurde im 9. Jahrhundert unverwest geborgen und in der Basilika „Santa Cecilia“ im römischen Trastevere beigesetzt. Eine besondere Bedeutung erhielt diese Heilige als Emblem der kirchenmusikalischen Reformbewegung im 19. Jahrhundert in Deutschland, die mit „Cäcilianismus“ bezeichnet wurde. Diese Bewegung machte sich zur Aufgabe, die Kirchenmusik wieder im alten Geiste (dem sogenannten „Palestrina-Stil“) zu pflegen. Da nicht nur die städtischen, sondern auch die dörflichen Musikvereine – vorzugsweise die Kirchenchöre und Musikkapellen – in der heutigen Zeit immer öfters gemeinsame Projekte verwirklichen, liegt es nahe eine „Gemeinschaftsmesse“ genau für diese beiden Musiziergemeinschaften bereitzustellen. Einer willkommenen Tradition folgend bietet sich dazu der „Cäcilien-Sonntag“ ganz besonders an. Vor allem an diesem prägnanten Termin sollten Musikvereine gemeinsam in Erscheinung treten. Die hier vorliegende „Cäcilien-Messe“ von Gottfried Veit ist für solche Anlässe geradezu prädestiniert, da sie zur Darbietung nicht nur den Kirchenchor und die Musikkapelle, sondern auch noch einen Kantor sowie den Gemeindegesang einbezieht. Mit ihren elf Teilen deckt diese Komposition sowohl die Ordinariums- als auch die Propriumsgesänge ab und zählt deshalb zu den sogenannten „Plenar-Messen“. Stilistisch ist diese Messkomposition zwar streng tonal gehalten, weist aber mit ihrer etwas neueren Tonsprache ebenso auch in die Zukunft. Natürlich können von dieser Messe auch nur einzelne Teile, die allesamt eine unüberhörbare Geschlossenheit zeigen, dargeboten werden. Der Schwierigkeitsgrad der vier Chorstimmen bewegt sich bewusst in relativ engen Grenzen. Auch die Instrumentation des Blasorchesters ist so angelegt, dass sämtliche Solo-Stellen von „Mangelinstrumenten“ – als Stichnoten – in adäquaten anderen Instrumentalstimmen aufscheinen. Nun bleibt nur noch zu wünschen, dass sich sowohl Sänger von Chören als auch Instrumentalisten von Musikkapellen an dieser neuen „Gemeinschaftsmesse“ erfreuen. Verlag: Tirol Musikverlag Schwierigkeitsgrad: Mittelschwer Spieldauer: 30´00´´ |
Tirol Musikverlag | |

Der Clown, Ringelreihen, Das Abendlied (2004)
Klavierstücke für Kinder
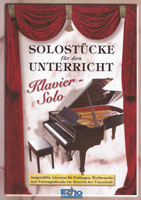
Im Gegensatz zu den Erwachsenen haben fast alle Kinder eine blühende Fantasie. Inspirationsquellen dazu sind für sie zum einen alles Spielerische, zum anderen aber auch unzählige Begriffe, die ihrer kindlichen Vorstellungskraft entsprechen. Die Titel der „Klavierstücke für Kinder“ von Gottfried Veit - von ihm gibt es übrigens rund zwei Dutzend solcher Spielstücke - deutet ganz bewusst darauf hin. Der Clown ist ein Spaßmacher, der vor allem im Zirkus immer für Heiterkeit sorgt. Hinter dieser Heiterkeit verbirgt sich aber nicht selten eine melancholische, ja sogar traurige Persönlichkeit. Musikalisch wird hier die Heiterkeit durch überraschende Melodiewendungen dargestellt. Die dazugehörende Melancholie steckt hingegen in den vier letzten Takten dieses kurzweiligen Musikstückes. Ringelreihen ist ein tänzerisches „Rondo“ („Rundgesang“ oder „Rundtanz“) dem ein zweitaktiges Hauptmotiv vorangestellt wird, das der sogenannten „Leiermelodik“ entspricht. Der Grundcharakter dieses Spielstückes kann als unbeschwert bezeichnet werden. Das Abendlied ist ein - wie könnte es anders sein – ruhiges und austruckstarkes Musikstück. Es lebt hauptsächlich von einem zweitaktigen Motiv, das in leicht variierter Gestalt mehrmals hintereinander erklingt. Unter diese einprägsame Melodie legt die linke Hand des Klavierspielers einen nahezu ostinaten Klangteppich. Verlag: Koch Musikverlag Schwierigkeitsgrad: Leicht |
Koch Musikverlag | |

Der Tharerwirt von Olang (1997)
Für Männerchor, zwei Trompeten, zwei Posaunen und Pauken

PETER SIGMAIR, der Tharerwirt von Olang, war einer der Tiroler Freiheitskämpfer um Andreas Hofer. Obwohl er militärisch nie eine führende Stellung bekleidete, zählt er – wegen seines Heldentodes – zu den großen Männern von 1809. Nach der Niederwerfung des Aufstandes der Tiroler, flüchtete Peter Sigmair auf den Geiselsberg oberhalb seines Heimatortes. Als ihn die gegnerischen Franzosen in seinem Wirtshaus zu Mitterolang vergebens suchten, griffen sie zum Mittel der Erpressung und verhafteten an seiner Stelle, seinen Vater. Als Peter Sigmair davon Kunde erhielt, verließ er sein sicheres Versteck und stellte sich den Feinden. Diese führten ihn vorerst – in Ketten – nach Bozen und verurteilten ihn später, im Gefängnis von Bruneck, zum Tode. Um ein besonders abschreckendes Exempel zu statuieren, brachte man den Tharerwirt am 14. Jänner 1810 in sein Heimatdorf, um ihn dort vor dem Baumgartnerhof standrecht zu erschießen. Sein Leichnam wurde sogar an einem Feldkreuz aufgehängt. DER THARERWIRT VON OLANG von Gottfried Veit wurde 1984, zum Tiroler Gedenkjahr, geschrieben und beim vorausgegangenen Internationalen Kompositionswettbewerb des Südtiroler Sängerbundes mit dem III. Preis ausgezeichnet. In der Jurybegründung heißt es u. a.: "Die Komposition zeichnet sich durch gute Satztechnik aus und ist mit einfachen technischen Mitteln darzustellen. Sie ist stark konventionell ausgerichtet und eignet sich insbesondere für Aufführungen im heimatkulturellen Bereich." Uraufgeführt wurde dieses Werk vom Männergesangsverein Schlanders unter der Leitung von Hans Tummler. Verlag: Tss Musikverlag Schwierigkeitsgrad: Mittel Schwer |
Tss Musikverlag | |

Der Zottelmarsch (2012)
Für Spielleute
Musik: Gottfried Veit Arrangement: Patrik Wirth 
Es gibt Melodien, die man nach einmaligem Hören bereits nachsingen kann. "Sie gehen ins Ohr" sagt man. Eine solche Melodie wird im Fachjargon als "Ohrwurm" bezeichnet. Ein typischer "Ohrwurm" ist der hier vorliegende "Zottelmarsch". Er zählt - da er mündlich überliefert wurde - zur Gattung der bodenständigen Volksmusik und soll seinen Ursprung in Kärnten haben. Mit dem "Zottelmarsch" wird das musikalische Klischee einer biederen, dörflichen Marschmusik auf humorvolle Weise persifliert. Dieser hier vorliegende Zottelmarsch, der als Ausgabe für Jugendkapellen bereits eine große Verbreitung gefunden hat, ist jetzt auch für "Spielleuteorchester" erschienen. Dank der freundlichen Genehmigung des Originalverlages (HeBu Musikverlag GmbH, Kraichtal) arrangierte Patrik Wirth dieses lustige Musikstück in gekonnter Weise für die Besetzung von 3 Piccolos in C, 3 Flöten in C, Altflöte in G, Bassflöte in C, Glockenspiel/Lyra, Xylophon, Marimbaphon, Elektro-Bass (ad lib.), Pauken, Snare Drum, Bass Drum und Cymbals. Nun können sich an diesem musikantischen Stück auch alle Spielleute erfreuen. Verlag: Musica Piccola Schwierigkeitsgrad: Leicht/Mittel Spieldauer: 2´33´´ |
Musica Piccola | |

Deutsches Requiem in a-Moll (2022)
Für gemischten Chor und Orgel
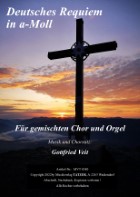
Das „Requiem“, auch Totenmesse, (Missa pro defunctis, Missa defunctorum, Messe für Verstorbene) hat seinen Namen von der ersten Zeile des „Introitus“ erhalten: „Requiem aeternam dona eis, Domine“ was zu Deutsch heißt: „Die ewige Ruhe schenke ihnen, Herr“. Es wird vor allem am 02. November, dem Allerseelentag, im Gedenken an alle im Glauben Verstorbenen dargeboten. Ebenso wird das Requiem bei Begräbnisgottesdiensten, am Todestag bestimmter Personen, aber auch zu anderen Gelegenheiten gesungen und gespielt. Breit angelegte Requien für Soli, Chor und Orchester schrieben beispielsweise Wolfgang Amadeus Mozart, Giuseppe Verdi und Hector Berlioz. Im Gegensatz zu diesen umfangreichen und weit ausladenden Meisterwerken entstanden im Laufe der Zeit auch Requien kleineren Ausmaßes, also für die alltägliche Praxis. Genau zu dieser Gattung zählt auch das DEUTSCHE REQUIEM in a-Moll für gemischten Chor und Orgel von Gottfried Veit. Während die großen Requien meist neun musikalische Teile aufweisen, kommt das ganz auf die Praxis abgestimmte hier vorliegende Requiem mit nur sieben Teilen aus und entspricht dadurch zum einen formal und zum anderen durch die Verwendung des deutschen Textes den Vorgaben des Zweiten Vatikanischen Konzils. Die Einzelteile dieses kirchenmusikalischen Werkes sind wie folgt überschrieben:
Um vor allem auch Chören mittlerer und unterer Leistungsstufen entgegen zu kommen, wurden hier bei der Vertonung des Requiem-Textes bewusst thematische und harmonische Repetitionen eingebaut, damit die Einstudierung dieser liturgischen Komposition nicht zu viel Zeit in Anspruch nimmt. Verlag: Tatzer Musikverlag Schwierigkeitsgrad: Leicht Mittel Spieldauer: ca. 15´ |
Tatzer Musikverlag | |

Franziskus-Messe (2002)
Für Vorsänger, gemischten Chor, zwei Trompeten, zwei Posaunen und Orgel

Von den vielen außergewöhnlichen Gestalten, die das Mittelalter hervorgebracht hat, hebt sich der heilige Franziskus besonders ab. Er war ein wohlhabender italienischer Kaufmannssohn, der eines Tages freiwillig allem Wohlleben entsagte und das Gelübde der Armut tat. Franziskus lebte von 1182 (1181?) bis 1226 in der kleinen umbrischen Stadt Assisi und gründete dort in den Jahren 1222/23 den Orden der Franziskaner, den ersten sogenannten Bettelorden. In seinem berühmt gewordenen "Sonnengesang" (Laudes creaturarum) preist er unaufhörlich die ganze Schöpfung, in deren Dienst er sich zum Lobe Gottes gestellt hat. Der heilige Franziskus ist sowohl als "Armer von Assisi" wie auch als "Christliche Lichtgestalt" in die Geschichte eingegangen. Die, hier vorliegende, "Franziskus-Messe" ist diesem allseits geschätzten Heiligen gewidmet. Sie verwendet den ökumenischen Ordinariumstext deutscher Sprache. Stilistisch möchte dieses sakrale Werk, durch die archaische Schlichtheit der - nahezu organal wirkenden - verwendeten Homophonie, an das äußerst karge Leben des Franz von Assisi erinnern. Der Einsatz von zwei Trompeten und zwei Posaunen - als Überhöhung des Orgelklanges - möchte andererseits aber auch als die große Strahlkraft dieses in die Zukunft weisenden Heiligen verstanden sein. Verlag: Tss Musikverlag Schwierigkeitsgrad: Mittel Schwer |
Tss Musikverlag | |

Gegrüßet seist du Königin (2010)
Für vierstimmigen gemischten Chor

Von den tradierten Marienliedern dürfte "Gegrüßet seist du Königin" eines der bekanntesten sein. Es ist auch mit der Nummer 573 in den Stammteil des Katholischen Gebet- und Gesangbuch "Gotteslob" eingegangen. Der derzeit aktuelle Text stammt aus Köln (1852) und wurde nach dem "Salve Regina-Lied" von Johann Georg Seidenbusch vom Jahre 1687 verfasst. Die erste Strophe davon lautet: Gegrüßet seist du Königin, o Maria, erhabne Frau und Herrscherin, o Maria! Freut euch ihr Cherubim, lobsingt, ihr Seraphim, grüßet eure Königin: Salve, salve, salve, Regina! Genau diesen Text hat auch Gottfried Veit für seine Neuvertonung verwendet. Er komponierte eine relativ einfache Motette in der bewährten dreiteiligen Liedform A-B-A’. Während in den beiden Eckteilen der volle Chor (SATB) singt, werden im Mittelteil die Bassstimmen ausgespart. Da diese Motette in kürzester Zeit einen sehr guten Anklang fand, schrieb Gottfried Veit davon auch eine Fassung für Männerchor (TTBB) und eine weitere Fassung für Oberchor (SSA). Verlag: Tss Musikverlag Schwierigkeitsgrad: Mittel Schwer |
Tss Musikverlag | |

Gutmütigkeit (2008)
Text: Eugen Roth, Musik: Gottfried Veit

Im Jahre 2007 organisierte die AGACH, die Arbeitsgemeinschaft alpenländischer Chorverbände, einen Kompositionswettbewerb für Oberstimmenchöre. Dabei ging die AGACH von der Erfahrung aus, dass nach Literatur genau dieser Besetzung eine besondere Nachfrage herrscht. Von den eingereichten Kompositionen wählte eine internationale Jury vierzehn Werke aus, unter denen sich natürlich auch die preisgekrönten Kompositionen befinden. Diese vierzehn Werke für Oberchor wurden im Anschluss an den Wettbewerb sowohl als Notenausgabe wie auch als Tonträger veröffentlicht. Ein Beitrag dieser Sammlung ist das schlichte Madrigal „Gutmütigkeit“. Dieses weltliche Lied – über einen tiefsinnigen Text von Eugen Roth – versucht auf anschauliche Weise den Inhalt dieses Textes in Musiknoten nachzuzeichnen. Die Komposition für Oberchor von Gottfried Veit ist teils drei-, teils vierstimmig gesetzt und entspricht einem mittleren Schwierigkeitsgrad. Verlag: Pro Organo Schwierigkeitsgrad: Mittel Spieldauer: 1´46´´ |
Pro Organo | |

Heilig Geist-Musik (2007)
Für zwei Trompeten, zwei Posaunen und Orgel

Entstanden ist die "Heilig Geist Musik" von Gottfried Veit für den TAG DER KIRCHENCHÖRE, der am 15. Oktober 2006 im Brixner Dom mit äußerst starker Beteiligung begangen wurde. Die "Heilig Geist Musik" erlebte dort, bei der nachmittäglichen Feierstunde - die das Motto "Atme in mir, Du heiliger Geist" trug - auch ihre Uraufführung. Dargeboten wurde diese sakrale Musik vom "Ensemble Euphorie" und dem Organisten Fr. Arno Hagmann. Da diese drei Instrumentalsätze für den Anfang, für die Mitte und für das Ende der Feierstunde geplant waren, erhielten sie nicht nur die dazu passenden Titel, sondern auch adäquate Inhalte. Das "Präludium" (Vorspiel) beginnt mit dem Themenkopf des bekannten Kirchenliedes "Komm, Schöpfer Geist" und wird in der Folge sehr festlich fortgeführt. Das "Interludium" (Zwischenspiel) verarbeitet auf meditative Weise den gregorianischen Choral "Veni, Creator Spiritus", der hier in fünf verschiedenen Gestalten erscheint. Das "Postludium" (Nachspiel) knüpft zwar in seinem Charakter an das "Präludium" an, steht aber nicht mehr in B-Dur, sondern in der strahlenden Naturtonart C-Dur und beendet die Komposition mit großer Festlichkeit. Auftraggeber dieser Komposition war der SÜDTIROLER KÜNSTLERBUND. Verlag: Tatzer Musikverlag Schwierigkeitsgrad: Mittel Schwer/Schwer |
Tatzer Musikverlag | |

In Pseier drin (2010)
Für Männerchor, zwei Trompeten und zwei Posaunen

Der Text des Liedes "In Pseier drin" stammt von der bekannten Südtiroler Mundartdichterin Maridl Innerhofer. Genau so schlicht wie der Text ist auch die Musik von Gottfried Veit. Man könnte sagen, sie ist einem Volkslied nachempfunden. Die Fassung für Männerchor (TTBB) und Blechbläserquartett wurde bei einem Abschlusskonzert des Kapellmeisterlehrganges des "Verbandes Südtiroler Musikkapellen" vom Lehrgangschor unter der Leitung von Josef Egger in St. Leonhard in Passeier uraufgeführt. Die Fassung für gemischten Chor (SATB) und kleines Orchester (zwei Klarinetten, zwei Trompeten, I. Violine, II. Violine, Viola, Cello und Kontrabass) wurde hingegen vom Kirchenchor St. Leonhard (Passeier) bei einem Bezirkstreffen verschiedener Chöre des "Südtiroler Chorverbandes" im Jahre 1988 im Peter Thalguterhaus in Algund uraufgeführt. Die Leitung hatte Albin Hofer. Eine weitere Fassung für dreistimmigen Oberchor (SSA), Gitarre und ein Melodieinstrument existiert von diesem Lied auch, sie ist aber nicht in Druck erschienen. Verlag: Tss Musikverlag Schwierigkeitsgrad: Leicht |
Tss Musikverlag | |

In Pseier drin (2010)
Für gemischten Chor und kleines Orchester (2 Klarinetten, 2 Trompeten und Streicher)

Der Text des Liedes "In Pseier drin" stammt von der bekannten Südtiroler Mundartdichterin Maridl Innerhofer. Genau so schlicht wie der Text ist auch die Musik von Gottfried Veit. Man könnte sagen, sie ist einem Volkslied nachempfunden. Die Fassung für gemischten Chor (SATB) und kleines Orchester (zwei Klarinetten, zwei Trompeten, I. Violine, II. Violine, Viola, Cello und Kontrabass) wurde vom Kirchenchor St. Leonhard (Passeier) bei einem Bezirkstreffen verschiedener Chöre des "Südtiroler Chorverbandes" im Jahre 1988 im Peter Thalguterhaus in Algund uraufgeführt. Die Leitung hatte Albin Hofer. Die Fassung für Männerchor (TTBB) und Blechbläserquartett wurde hingegen bei einem Abschlusskonzert des Kapellmeisterlehrganges des "Verbandes Südtiroler Musikkapellen" vom Lehrgangschor unter der Leitung von Josef Egger in St. Leonhard in Passeier uraufgeführt. Eine weitere Fassung für dreistimmigen Oberchor (SSA), Gitarre und ein Melodieinstrument existiert von diesem Lied auch, sie ist aber nicht in Druck erschienen. Verlag: Tss Musikverlag Schwierigkeitsgrad: leicht |
Tss Musikverlag | |

Jetzt fängt das schöne Frühjahr an (2008)
Volkslied für dreistimmigen Oberchor arrangiert

Im Jahre 2007 organisierte die AGACH, die Arbeitsgemeinschaft alpenländischer Chorverbände, einen Kompositionswettbewerb für Oberstimmenchöre. Dabei ging die AGACH von der Erfahrung aus, dass nach Literatur genau dieser Besetzung eine besondere Nachfrage herrscht. Von den eingereichten Kompositionen wählte eine internationale Jury vierzehn Werke aus, unter denen sich natürlich auch die preisgekrönten Kompositionen befinden. Diese vierzehn Werke für Oberchor wurden im Anschluss an den Wettbewerb sowohl als Notenausgabe wie auch als Tonträger veröffentlicht. Ein Beitrag dieser Sammlung ist das allgemein verbreitete Volkslied „Jetzt fängt das schöne Frühjahr an“ von dem nicht nur der Text, sondern auch die Melodie aus dem Rheinland stammt. Gottfried Veit schrieb zu diesem beliebten Frühlingslied einen dreistimmigen Chorsatz für zwei Sopran- und eine Altstimme. Verlag: Pro Organo Schwierigkeitsgrad: Leicht Spieldauer: 1`06`` |
Pro Organo | |

La Cucaracha (2015)
Für Brass Band
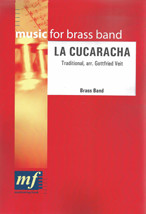
Es gibt nicht nur in der sogenannten U-Musik „Schlager“. Auch die Klassische Musik und vor allem die volks- und volkstümliche Musik haben Melodien hervorgebracht, die bei der breiten Masse förmlich „einschlagen“. Zu dieser Gattung zählt ohne Zweifel die stark rhythmisierte Tonfolge von „La Cucaracha“. Wie so manche besonders eingängige Melodie, stammt auch diese aus Latein-Amerika. Von ihrem Wesen her erinnert „La Cucaracha“ stark an den Charakter des Calypso. Der Ausdruck „Cucaracha“ ist mehrdeutig: zum einen bedeutet er Küchenschabe, zum anderen ist er der Spitzname für ein Küchenmädchen und nicht zuletzt spielt er auf den heruntergekommenen General Victoriano Huerta an, der ohne Marihuana „nimmer gehn“ konnte. In den unzähligen recht humorvollen Textvarianten dieses mexikanischen Tanzliedes wird mit Vorliebe auf Persönlichkeiten und Personen verschiedenster Herkunft Bezug genommen. Verlag: Musikverlag Frank Schwierigkeitsgrad: Leicht/Mittel Spieldauer: 3´10´´ |
Musikverlag Frank | |

Maria, dich lieben (2013)
Zehn marianische Weisen für ein, zwei, drei oder vier Alphörner gleicher Stimmung
Bearbeitung: Gottfried Veit 
Die Marienverehrung hat eine nahezu zweitausendjährige Tradition. Sie drückt sich in Malerei, Plastik, Poesie und nicht zuletzt auch in Musik aus. Nach einer Legende hörten die Apostel über dem Grab Mariens drei Tage lang „himmlische Musik“. Die katholische Kirche feiert zu Ehren der Mutter Jesu eine ganze Reihe von Marienfeste. Die bekanntesten davon sind: Hochfest der Gottesmutter (1. Jänner), Maria Lichtmess (2. Februar), Maria Verkündigung (25. März), Maria Heimsuchung (2. Juli), Maria Himmelfahrt (15. August), Maria Geburt (8. September), Maria Namen (12. September) und das Fest der unbefleckten Empfängnis (8. Dezember). Zudem sind der Mai (Maiandachten), der Oktober (Rosenkranzmonat) und der Dezember (Adventszeit) Monate, in denen die Marienverehrung besonders gepflegt wird. Eine überaus lange Tradition hat auch das (kultische) Alphornblasen. Da es gar nicht wenige „naturtönige“ Marienlieder gibt, wurde im hier vorliegenden kleinen Kompendium versucht, genau diese Weisen zusammen zu tragen. Die mehrstimmigen Sätze wurden so eingerichtet, dass sie vierstimmig, dreistimmig (bei Weglassung der dritten Stimme), zweistimmig (nur erste und zweite Stimme) aber auch einstimmig - d. h. solistisch - dargeboten werden können. Der Ambitus der Primstimme reicht nach oben bis zum notierten zweigestrichenen g. Ob das „Alphorn-F“ naturtönig oder wohltemperiert intoniert wird, sei dem Geschmack des jeweiligen Bläsers vorbehalten. Verlag: Editions Marc Reift Schwierigkeitsgrad: Mittel |
Editions Marc Reift | |

Markus-Messe (2016)
Missa brevis für gemischten Chor, Orgel, zwei Violinen und Violoncello (ad lib.)

Wie bereits aus dem Titel dieser „Missa brevis“ hervorgeht, ist ihr Widmungsträger der Heilige Markus. Der Apostel Markus, eigentlich Johannes Markus, stammt aus Jerusalem und war zeitweiliger Missionsbegleiter des Apostels Paulus. Er ist einer der vier Evangelisten und verfasste im Auftrag Petri das Zweite Evangelium. Als Bischof von Alexandrien überfielen ihn christenfeindlich gesinnte Einwohner am Altar und schleiften ihn mit einem Strick um den Hals im Jahr 68 n. Chr. zu Tode. Sein Namensfest wird am 25. April gefeierte. Da die Reliquien dieses Apostels und Märtyrers nach Venedig gebracht wurden, erwählte ihn die Lagunenstadt zum Schutzpatron der Republik Venedig. In Venedig erinnert u. a. noch heute der weltberühmte Markus-Dom an diesen außergewöhnlichen Heiligen. Die MARKUS-Messe für gemischten Chor (SATB), Orgel, zwei Violinen und Violoncello von Gottfried Veit verzichtet bewusst auf eine zeitgenössische Tonsprache, damit sie von möglichst vielen Chören dargeboten werden kann. Da sie auf die alltägliche Chorpraxis Rücksicht nimmt, kann sie zudem in drei verschiedenen Versionen dargeboten werden:
Nun wünschen wir der hier vorliegenden MARKUS-Messe, dass sie bei den Chorgemeinschaften gut ankommt und bei deren Darbietung viel Freude bereitet. Anstelle der Streicherstimme sind zu dieser Mess-Komposition auch Instrumentalstimmen für zwei B-Klarinetten und Bassklarinette erschienen, die beim Musikverlag TATZER angefordert werden können. Verlag: Tatzer Musikverlag Schwierigkeitsgrad: Leicht/Mittel Spieldauer: 10´32´´ |
Tatzer Musikverlag | |

Messe in Es (Leonfeldner Messe) von Karl Pauspertl (1989)
Für Blasorchester und Chor
Chorsatz (SATB) von Gottfried Veit 
Karl Pauspertl (von Drachenthal) wurde am 18. Oktober 1897 in Plevlje, in Serbien, geboren und starb am 6. April 1963 in Wien. Als Sohn eines österreichischen Offiziers studierte er Musik und Philosophie in Wien, war Theater- sowie Militärkapellmeister und ging als letzter Dirigent des Wiener Hoch- und Deutschmeister-Regiments Nr. 4 in die Militärmusikgeschichte ein. Als Komponist schrieb Karl Pauspertl eigene Operetten und bearbeitete auch solche anderer Tonschöpfer erfolgreich. Welterfolg erlangte er aber mit seinen Filmmusiken. Die "Messe in Es" ("Leonfeldner Messe") bildet – als Sakralmusik – in seinem Schaffen ohne Zweifel eine Ausnahme. Sie umfasst die Teile "Kyrie", "Gloria", "Graduale", "Credo", "Offertorium", "Sanktus", "Benediktus", "Agnus" und "Schlussgesang", deren Texte W. Alfred Höss beisteuerte. Die ursprüngliche Fassung dieser Plenar-Messe ist für (einstimmigen) Gesang und Blasorchester. Da sich die einzelnen Messteile hervorragend auch für Chorgesang eignen, erstellte der Südtiroler Landeskapellmeister Gottfried Veit erst vor einigen Jahren dazu einen vierstimmigen Satz für gemischten Chor. Durch diese Ergänzung kann nun die "Messe in Es" von Karl Pauspertl in drei verschiedenen Versionen dargeboten werden:
Verlag: Tatzer Musikverlag Schwierigkeitsgrad: Mittel Schwer |
Tatzer Musikverlag | |

Musik im Jahreskreis (1992)
Kantate für die Vereine eines Dorfes
(Für gemischten Chor, Kinderchor, Männerchor ad lib., Tenor, Sprecher, Sprecherin, Bläserquintett und Blasorchester) 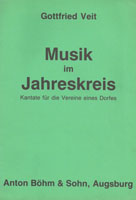
Angeregt von der Tatsache, dass es im gesamten deutschen Sprachraum – aber besonders in den dörflichen Bereichen – ein überaus gedeihliches Vereinsleben gibt, ließ sich der Komponist Gottfried Veit zu seiner "Kantate für die Vereine eines Dorfes" inspirieren. Diese Komposition mit dem Titel "Musik im Jahreskreis" kann als typische Gebrauchsmusik bezeichnet werden, welche sich die Förderung des Gemeinschaftsmusizierens zur Aufgabe gemacht hat. Als Mitwirkende sieht sie einen gemischten Chor, einen Kinderchor, einen Männerchor (ad lib.), zwei Sprechstimmen, einen Solosänger, eine (kleine) Musikkapelle sowie eine Bläsergruppe von fünf Instrumentalisten vor. Wenn in dieser Komposition der Gemischte Chor und der Kinderchor auch den Hauptteil zu bestreiten haben, so ist sie doch nicht eine reine Chorkantate: Episches und Lyrisches sind darin in gleicher Weise vertreten. Der "Jahreskreis" beginnt (nach einem kurzen Präludium der Musikkapelle) und endet mit dem Neujahrslied aus Westfalen "Das alte ist vergangen". Unter diesem Bogen werden eine ganze Reihe von bekannten und weniger bekannten Frühlings- Sommer-, Herbst- und Winterlieder gestellt, die in bunter Folge sich mit Gedichten (von Ludwig Uhland, Friedrich Hebbel und Paul Hermann) und Erzählertexten abwechseln. Während das Bläserquintett – mit Flöte, Oboe, Klarinette, Horn und Fagott – eher Begleitfunktion besitzt, so spielt die Musikkapelle mit kleinen Instrumentalsätzen (wie Präludium, Menuett, Marsch usw.) eindeutig eine verbindende d. h. umrahmende Rolle. Gesamtheitlich gesehen ist diese relativ leicht darzubietende Kantate nach dem Prinzip von Abwechslung und Steigerung konzipiert. Ihre Uraufführung erlebte sie im Bürger- und Rathaus in Naturns unter der Gesamtleitung von Josef Pircher am 25. November 1989. Die Aufführungsdauer beträgt etwas mehr als eine halbe Stunde. Verlag: Böhm & Sohn Schwierigkeitsgrad: Mittel Schwer |
Böhm & Sohn | |

Oster-Postludium „Das große Halleluja“ (2015)
Für drei Trompeten, drei Posaunen, Röhrenglocken und Kirchenorgel
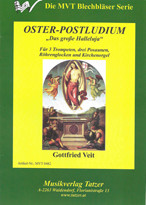
Ostern ist das höchste Fest der katholischen Kirche. Zu Ostern wird die Auferstehung Jesu Christi gefeiert. Nach diesem besonderen Fest richten sich alle anderen Festtage des Kirchenjahres wie beispielsweise Christi Himmelfahrt, Pfingsten und Fronleichnam. Das Datum des Osterfestes hängt mit dem jüdischen Zeit- und Festtagskalender zusammen, bei dem die Monate jeweils mit dem Tag des Neumondes begannen. Ostern zählt auch zu den ältesten Festen der Christenheit. Bereits im 4. Jahrhundert wurde es als „Fest der Feste“ sehr feierlich begangen. Sehr feierlich ist auch das OSTER-POSTLUDIUM von Gottfried Veit, welches als Untertitel „Das große Halleluja“ trägt. Dieses Postludium ist für sechs engmesurierte Blechblasinstrumente, Röhrenglocken und Kirchenorgel konzipiert, die durch ihre Klangpracht die Festlichkeit dieses besonderen Tages zum Ausdruck bringen. Eingerahmt wird dieses majestätische Musikstück vom Unisono-Themenkopf des allseits bekannten Osterliedes „Christ ist erstanden“, welches bereits 1150 in Salzburg erstmals erwähnt wird. Das eigentliche Hauptthema der Komposition, das von den drei Trompeten angestimmt wird, erklingt im Laufe der Komposition auch in der Orgel. Die Röhrenglocken geben der zwar kurzen aber deshalb nicht weniger prägnanten Komposition ein besonders feierliches Gepräge. Verlag: Tatzer Musikverlag Schwierigkeitsgrad: Mittel/Schwer Spieldauer: 2´15´´ |
Tatzer Musikverlag | |

Passacaglia (2006)
Für zwei Orgeln

Die "Passacaglia" ist eine Komposition über einen Ostinato von vier oder acht Takten, die in der Regel in ternären Taktarten notiert wird. Girolamo Frescobaldi schrieb im Jahre 1614 das erste Werk dieser Gattung. Wurde diese Instrumentalform im 19. Jahrhundert weitgehend vergessen, so hat sie - seit der Wiederbesinnung auf die Musik des Barock - eine unüberhörbare Renaissance erlebt. Die hier vorliegende Passacaglia für eine große und eine kleine Kirchenorgel greift zwar Elemente der historischen Struktur auf, versucht ihr aber auch Eigenleben einzuhauchen. Einerseits wird bei dieser Passacaglia der Kernteil von einem Vor- und einem Nachspiel eingerahmt und andererseits erhält sie durch den Dialog zwischen den beiden Orgeln eine ungewöhnliche Farbigkeit. Während die beiden Eckteile meditativen Charakter aufweisen, ist der Mittelteil eine Art komponiertes "crescendo" bzw. "decrescendo". Im Laufe dieses Abschnittes erscheint das Hauptthema in sechs unterschiedlichen Klanggestalten und in drei verschiedenen Tonarten. Natürlich hängt der Reiz der Farbigkeit dieser Komposition weitgehend von der Qualität der zur Verfügung stehenden Instrumente, aber auch von der Registrierkunst der interpretierenden Organisten ab.
Verlag: Tss Musikverlag Schwierigkeitsgrad: Mittel Schwer Spieldauer: 6´20´´ |
Tss Musikverlag | |

Passacaglia und Hymnus (2021)
Für zwei Orgeln und Röhrenglocken

Da es schon seit rund achthundert Jahren Orgelmusik gibt und fast alle bedeutenden Komponisten auch Werke für dieses Instrument geschrieben haben, existiert heute eine fast unüberschaubare Anzahl an Orgelkompositionen. Unter diesen Kompositionen befinden sich natürlich auch unzählige Meisterwerke aller Stilepochen. Aus diesem Grunde schrieb der Südtiroler Komponist Gottfried Veit bis heute fast ausschließlich nur Werke für Orgel in Verbindung mit einem oder mehreren Instrumenten. Und genau zu dieser Werkgattung zählt auch seine hier vorliegende Komposition „Passacaglia und Hymnus“ für zwei Orgeln und Röhrenglocken. Wie bereits aus dem Titel hervorgeht, handelt es sich bei dieser Komposition um ein zweiteiliges Werk, dem aber – ausgeführt durch die Röhrenglocken – das gregorianische Kopfthema von „Te Deum laudamus“ („Dich, Gott, loben wir“) vorangestellt wird. Die darauffolgende Passacaglia ist traditionsgemäß im Dreivierteltakt notiert und besteht aus einem achttaktigen Thema, das sowohl im Monolog als auch im Dialog von den beiden Orgeln dargeboten wird. Nach einer kurzen modulatorischen Überleitung erklingt anschließend der im Viervierteltakt notierte, in ausladender Form und in der Tonart der Subdominante konzipierte Hymnus. Nach einem viertaktigen Orgelpunkt auf der Dominante steigert sich der Hymnus, vereint mit dem Geläute der Röhrenglocken, zu einem fulminant abschließenden Kulminationspunkt. Verlag: Tatzer Musikverlag Schwierigkeitsgrad: Mittelschwer Spieldauer: 4´10´´ |
Tatzer Musikverlag | |

Postludium (2021)
Für zwei Orgeln und vier Pauken

Nachdem die Komposition „Passacaglia und Hymnus“ für zwei Orgeln und Röhrenglocken des Südtiroler Komponisten Gottfried Veit nicht nur vom Kirchenvolk, sondern auch von der Fachwelt mit Begeisterung aufgenommen wurde, schrieb er unmittelbar danach ein weiteres, ähnliches Werk. Diesmal treten zu den beiden Kirchenorgeln nicht Röhrenglocken, sondern zwei Paukenpaare hinzu. Auch diese Klangkombination ist Ausdruck einer besonderen Feierlichkeit. Seine Uraufführung erlebte das hier vorliegende „Postludium“ beim Abschluss des Vierzigstündigen Gebetes am 01. März 2022 in der Stiftspfarrkirche Muri-Gries in Bozen. An den beiden Orgeln musizierten Dominik Bernhard sowie P. Urban Stillhard und die vier Pauken wurden von Johannes Riegler gespielt. Das „Postludium“ von Gottfried Veit entspricht formal einem kleinen Rondo (A-B-A-C-A), das von einem kurzen Vor- und einem etwas längerem Nachspiel eingerahmt wird. Die rund vierminütige Komposition ist im Viervierteltakt notiert und trägt die Vortragsbezeichnung „Maestoso“. Die Orgel Nr. 1 (Große Orgel) hat ohne Zweifel musikalisch die führende Rolle, daher sollten die Pauken in ihrer Nähe aufgestellt werden. Die Orgel Nr. 2 (Kleine Orgel) ist zwar spieltechnisch weniger gefordert als ihre große Schwester, hat aber neben dem Echospiel auch mehrere relativ leicht zu realisierende Sechzehntel-Läufe beizusteuern. Während sich das Wechselspiel der beiden Orgeln hauptsächlich in den beiden kontrastierenden Zwischensätzen (B und C) abspielt, kommt es zum Schluss dieses Werkes zu einem sich immer mehr steigernden Kulminationspunkt. Verlag: Tatzer Musikverlag Schwierigkeitsgrad: Mittelschwer Spieldauer: 3´23´´ |
Tatzer Musikverlag | |

Ruf der Freundschaft (2001)
Für drei Alphörner
Siglinde und Toni Hassler gewidmet 
Das Alphorn dürfte eines der ältesten Blasinstrumente sein. Diese langgestreckte „Holztrompete“ wurde früher aus einem einzigen gehöhlten - in der richtigen Krümmung gewachsenen - Tannenstamm hergestellt. Das Rohr ist in den meisten Fällen gerade und zeigt am unteren Ende nach oben. Seine Länge kann bis zu vier Metern betragen. Die Stimmung der Alphörner ist unterschiedlich: am verbreitetsten sind jene Instrumente in der F-Stimmung. Seit einigen Jahrzehnten fand dieses eher primitive Hirteninstrument sogar Einzug in die Kunstmusik. Das wohl bekannteste Alphornstück aus der Feder des Südtiroler Komponisten Gottfried Veit ist sein „Ruf der Freundschaft“. Dieses gemütvolle Musikstück für drei Alphörner gleicher Stimmung ist im Dreivierteltakt notiert. Gottfried Veit widmete es dem damaligen Bundesbeauftragten für das Alphornwesen im „Allgäu Schwäbischen Musikbund“ (ASM) Toni Haßler und seiner Frau Sieglinde. Verlag: Allgäuer Zeitungsverlag Schwierigkeitsgrad: Leicht Spieldauer: 0´50´´ |
Allgäuer Zeitungsverlag | |

Seifner Alphornruf (2009)
Für vier Alphörner

Augenzwinkernd wird heute das Alphorn nicht selten als das „Handy des Mittelalters“ bezeichnet. In der Tat, diese Naturinstrumente aus Holz dienten viele Jahrhunderte den Menschen hauptsächlich zur Nachrichtenübermittlung. Alphörner gibt es nicht nur in den Berggebieten und da wieder vorzugsweise in der Schweiz. Verwandte Formen dieses Naturinstruments werden auch in den Pyrenäen, in Skandinavien, Estland, Polen, Rumänien, ja sogar in Kirgisistan geblasen. Während die Alphörner in früheren Zeiten fast ausschließlich als „Verständigungsmittel“ dienten, werden sie heute auch „konzertant“ eingesetzt. Der „Seifner Alphornruf“ wurde von Gottfried Veit der gleichnamigen Alphorngruppe und ihrem Leiter Paul Hartmann zugeeignet. Das Stück selbst ist vierstimmig und soll „Mit Ausdruck“ dargeboten werden. Da die „Seifner Alphorngruppe“ über einen hervorragenden Stimmführer verfügt, kommt bei diesem Stück in der Primstimme nicht nur das sogenannte „Alphorn-F“, sondern sogar das notierte zweigestrichene „a“ zur Anwendung. Verlag: Alphorn-Center Verlag Schwierigkeitsgrad: Schwer Spieldauer: 1´05´´ |
Alphorn-Center Verlag | |

St. Josefs-Messe (2008)
Für Solostimme, gemischten Chor, (Klassisches Bläserquintett ad lib.) und Orgel

Der Name JOSEPH oder JOSEF stammt aus dem Hebräischen und heißt soviel wie "Gott fügt hinzu". Der heilige Josef, ein Zimmermann aus Nazareth, war der Mann Mariens und Pflegevater Jesu. Von ihm ist uns in der Heiligen Schrift kein einziger Ausspruch überliefert. Der heilige Josef ist vielleicht gerade deswegen ein besonders liebenswerter und großer Heiliger, weil er ohne viele Worte immer das getan hat, was Gott von ihm wollte. Sein Gedenktag wird jeweils am 19. März gefeiert. Sankt Josef ist Schutzpatron der ganzen Kirche. Er wird aber auch als Patron der Eheleute und Familien, der Kinder und Jugendlichen, der Erzieher sowie der Arbeiter und Handwerker verehrt. Zudem ist er Schirm- und Schutzherr des Landes Tirol. Dem Wesen des heiligen Josefs entsprechend, wurde die hier vorliegende lateinische "St. Josefs-Messe" ganz bewusst schlicht gehalten. Sie entspricht einer Plenarmesse, da sie die wichtigsten Teile des Ordinariums mit jenen des Propriums vereint. Verzichtet wurde auf die Vertonung des besonders textreichen "Credo", das in der heutigen Zeit ohnehin meist gebetet, anstatt gesungen wird. Das "Offertorium" hebt sich von den anderen Messteilen deshalb augenscheinlich ab, weil es als vierstimmiger a cappella-Gesang konzipiert ist und einen lateinischen Text aus dem Jahre 950 verwendet. Insgesamt besteht diese hier vorliegende Messvertonung aus acht Teilen. Als Eckteil scheint sowohl eine "Einzugs-" als auch eine "Auszugsmusik" auf, die rein instrumental darzubieten ist. Da diese "St. Josefs-Messe" für dem praktischen Gebrauch dienen soll wurde sie so angelegt, dass sie mit einer Solostimme, gemischten Chor und Orgel relativ leicht darzubieten ist. Für besonders festliche Anlässe kann zur vorhin genannten Besetzung noch ein klassisches Bläserquintett hinzutreten, das in mehrerlei Hinsicht eine klangliche Bereicherung des Werkes darstellt. In diesem Falle, sollte der Organist jedoch die kleingedruckten Stichnoten nicht spielen. Möge diese "St. Josefs-Messe" sowohl den Ausführenden als auch den Zuhörern viel Freude bereiten. Verlag: Tss Musikverlag Schwierigkeitsgrad: Mittel Schwer |
Tss Musikverlag | |

Stille Nacht, heilige Nacht (2001)
36 Advents- und Weihnachtslieder für variable Besetzung (Holz, Blech, Streicher, Blockflöten, Gem. Ensemble, Blasorchester und Volksgesang ad lib.)

Die derzeit gebräuchlichsten Weihnachtslieder stammen aus dem 18. und 19. Jahrhundert wie beispielsweise "Stille Nacht, heilige Nacht", "O du fröhliche, o du selige", "Alle Jahre wieder", "Ihr Kinderlein kommet" u. v. m. Die Existenz von Krippen- und Hirtenliedern kann aber schon seit dem 11. und 12. Jahrhundert nachgewiesen werden. Die hier vorliegende Sammlung enthält über dreißig Advents- und Weihnachtslieder, die sich in unserem Kulturkreis besonderer Beliebtheit erfreuen. Die vierstimmigen Sätze entsprechen entweder den Originalen oder tradierten Singgewohnheiten. Jedem Lied wurde ein kurzes Vorspiel, also eine Intonation, vorangestellt. Während die vier Stimmen als "Grundsatz" anzusehen sind, handelt es sich bei der fünften- lediglich um eine "Oktavkoppel" der Bassstimme. Diese Ausgabe kann zum einen als Volksgesangsbegleitung (mit Vorspielen), aber zum anderen auch als reine Instrumentalmusik (ohne Vorspiele) verwendet werden. Ausgeführt können die Liedsätze von einer Orgel (Klavier), von Blechbläsern, Holzbläsern, Streichinstrumenten, gemischten Ensembles, aber genauso gut auch von einer Musikkapelle oder einem Blasorchester. Sogar das Mitspielen von Streichinstrumenten, Blockflöten bis hin zur Zither, Hackbrett usw. ist möglich. Es muss lediglich auf eine gleichgewichtige Verteilung der vier bzw. fünf Stimmen geachtet werden. Die Stimmenausstattung ist äußerst mannigfaltig und beinhaltet folgende Einzelstimmen:
Verlag: Koch Musikverlag Schwierigkeitsgrad: Leicht |
Koch Musikverlag | |

Tanzen, tanzen (2008)
Text: Volksgut, Musik: Gottfried Veit

Im Jahre 2007 organisierte die AGACH, die Arbeitsgemeinschaft alpenländischer Chorverbände, einen Kompositionswettbewerb für Oberstimmenchöre. Dabei ging die AGACH von der Erfahrung aus, dass nach Literatur genau dieser Besetzung eine besondere Nachfrage herrscht. Von den eingereichten Kompositionen wählte eine internationale Jury vierzehn Werke aus, unter denen sich natürlich auch die preisgekrönten Kompositionen befinden. Diese vierzehn Werke für Oberchor wurden im Anschluss an den Wettbewerb sowohl als Notenausgabe wie auch als Tonträger veröffentlicht. Ein Beitrag dieser Sammlung ist das Lied „Tanzen, tanzen“ von Gottfried Veit. Während der Text dieses Liedes zum Volksgut zählt, hat Gottfried Veit daraus ein „Tanzlied“ für zwei Sopran und eine Altstimme kreiert. Diese tänzerische Vokalkomposition kann ganz besonders Kinder- und Jugendchören empfohlen werden. Verlag: Pro Organo Schwierigkeitsgrad: Leicht Spieldauer: 0´45´´ |
Pro Organo | |

Tiroler Lieder-Suite (2009)
Für gemischten Chor zusammengestellt und arrangiert:
Zu Mantua in Banden, Ach Himm´l es ist verspielt, Jesu Herz, dich preist mein Glaube, Auf zum Schwur, Tiroler Land 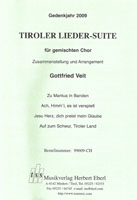
Die vier Lieder die hier zu einer "Tiroler Lieder-Suite" zusammengefasst wurden haben eines gemeinsam: sie markieren bedeutungsvolle Ereignisse der Geschichte Tirols. Das Lied "Zu Mantua in Banden", das gerne als das "Neue Andreas Hofer-Lied" bezeichnet wird, wurde am 02. Juni 1948 mit Gesetz des Tiroler Landtages zur "Tiroler Landeshymne" erhoben. Der Text dieses Liedes stammt von Julius Mosen (1803-1867), der neben zahlreichen Gedichten und Balladen auch Dramen sowie historische Trauerspiele verfasste. Die Musik von "Zu Mantua in Banden" schrieb der in Klosterneuburg geborene Komponist Leopold Knebelsberger (1814-1869). Neben dem im Jahre 1844 komponierten "Andreas Hofer-Lied" schrieb Knebelsberger noch nahezu 300 volkstümliche Lieder und Instrumentalstücke. Als das "Alte Andreas Hofer-Lied" gilt allgemein das Tiroler Volkslied "Ach, Himm’l, es ist verspielt". Mündlichen Überlieferungen nach soll Andreas Hofer (1767-1810) dieses Lied in den Tagen vor seinem Tod - er wurde am 20. Februar 1810 in Mantua von den Franzosen erschossen - im Gefängnis von Mantua gedichtet haben. Es weist gewisse Ähnlichkeiten mit einem damals sehr bekannten Soldatenlied auf, das aus der Zeit um 1780 stammt. "Ach, Himm’l, es ist verspielt" besitzt einen epischen Charakter, da dieses Lied den Dialog zwischen einem Soldaten und dem Tod darstellt. Angesichts der militärischen Bedrohung Tirols durch Frankreich, gelobten die Landstände 1796 die besondere Verehrung des heiligsten Herzens Jesu. ("Herz-Jesu-Bündnis"). Dieses Gelöbnis wird bei festlichen Gottesdiensten in ganz Tirol, am "Herz-Jesu-Sonntag", Jahr für Jahr erneuert. An diesen Gedenktagen wird es wohl kaum eine kirchliche Feier geben, bei der nicht das Lied "Jesu Herz, dich preist mein Glaube" erklingt. Die Weise dieses Liedes stammt aus dem Jahre 1876 und wurde von C. Jaspers erdacht. Der gegenwärtig verwendete Text erhielt 1950 durch Maria Luise Thurnmair eine gleichermaßen würdige wie gültige Form. Der ehemalige Brixner Domkapellmeister und Komponist Ignaz Mitterer (1850-1924) schrieb über 200 Werke, von denen der Großteil der sakralen Musik angehört. In seinem umfangreichen Oeuvre finden sich nicht weniger als 40 Messen, aber auch zahlreiche weltliche Lieder und Chorwerke. Im Jahre 1896, also zur Hundertjahrfeier des Tiroler Gelöbnisses, komponierte Ignaz Mitterer das heute allseits bekannte Herz-Jesu-Bundeslied "Auf zum Schwur, Tiroler Land". Dieses Lied, nach einem Text von Josef Seeber, wurde in mehrere Sprachen übersetzt und hat sich überaus weit verbreitet. Verlag: Tss Musikverlag Schwierigkeitsgrad: Mittel Schwer |
Tss Musikverlag | |

Toccata (2023)
Für zwei Orgeln, vier Blechbläser (und Pauken ad lib.)

Das Herzstück des Klosters Muri-Gries (Bozen) ist zweifelsohne die prächtige, barocke Stiftspfarrkirche. In diesem beeindruckenden Sakralraum befinden sich schon seit Jahren zwei große Kirchenorgeln: zum einen die Augustinus-Orgel auf der Empore und zum anderen die Benediktus-Orgel im Presbyterium, deren Spieltisch im Chorgestühl integriert ist. Für diese beiden Orgeln schrieb der Südtiroler Komponist Gottfried Veit schon mehrere Werke. Bereits 2006 entstand eine „Passacaglia“ für zwei Orgeln, die auf diesen beiden Instrumenten uraufgeführt wurde. 2021 schrieb er ein weiteres Stück mit dem Titel „Passacaglia und Hymnus“ für zwei Orgeln und Röhrenglocken, 2022 ein „Postludium“ für zwei Orgeln und vier Pauken sowie 2023 eine „Toccata“ für zwei Orgeln, zwei Trompeten, zwei Posaunen und zwei Pauken. Diese „Toccata“ weist eine Rondo-Form auf und ist dreichörig konzipiert. Den ersten Chor bildet die Große Orgel (zweite Orgel), den zweiten- das Blechbläserquartett mit den Pauken und den dritten- die Kleine Orgel (erste Orgel). Das Paukenpaar, welches zwar die Festlichkeit der Komposition deutlich unterstreicht, kann eventuell auch unbesetzt bleiben. Werden die Blechbläser und die Pauken in unmittelbarer Nähe der Hauptorgel positioniert, erleichtert dies natürlich das Zusammenspiel. In diesem Falle verzichtet man aber auf den besonderen Effekt der Dreichörigkeit. Die „Toccata“ beginnt mit einem etwas ausladenden Bläserruf der ersten Trompete. Dieser wird auf der Dominante von der ersten Posaune erwidert. Nach einem kurzen Tutti erklingt im Anschluss daran das eigentliche Hauptthema im Dreivierteltakt. Es wird zweimal von einem Zwischenteil im Viervierteltakt unterbrochen und schließlich durch eine modulatorische Rückung in die Tonart der Obersekunde versetzt. Eine kompakte „Coda“ im vollen Plenum führt das Werk dann zum finalen Höhepunkt. Verlag: Tatzer Musikverlag Schwierigkeitsgrad: Mittelschwer Spieldauer: 4´15´´ |
Tatzer Musikverlag | |

Trialog (2000)
Für zwei Orgeln, zwei Trompeten und Röhrenglocken

Beim Werk TRIALOG von Gottfried Veit handelt es sich um einen Kompositionsauftrag des Südtiroler Künstlerbundes. Da dieses Werk in Hinblick auf eine Darbietung im Bozner Dom komponiert wurde, sind mehrere Besonderheiten dieses sakralen Raumes mitberücksichtigt worden: Einerseits ist der Dom bzw. die Bozner Propsteipfarrkirche eine \"Maria Himmelfahrts-Kirche\" und andererseits besitzt dieses Gotteshaus eine große- sowie eine kleine Orgel. Als Huldigung an die Muttergottes wurde nicht nur die bekannte Liedweise \"Maria, dich lieben ist allzeit mein Sinn\" (Paderborn 1765) ins Zentrum der Komposition gestellt; das Werk beginnt zudem mit dem berühmten \"Salve Regina-Thema\", (in den Röhrenglocken) dessen Disposition der Anordnung der vier Kirchenglocken des Bozner Domes entspricht. Während die beiden Orgeln teilweise durch Mischklänge und harmonische Überraschungen das Transzendentale darzustellen versuchen, signalisiert das naturtönige Trompetenpaar, mit nahezu archaischen Klanggestalten, die Erdverbundenheit des Menschen. Am Ende der Komposition, verschmelzt sich dann Dies- und Jenseitiges zu einer übergeordneten Einheit. Verlag: Tatzer Musikverlag Schwierigkeitsgrad: Schwer |
Tatzer Musikverlag | |

Variationen für Bläserquintett (2002)
Über ein Thema von N. Paganini
Für Flöte, Oboe, Klarinette, Horn und Fagott 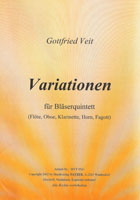
Die VARIATION ist ein elementares Kompositionsmittel, dessen sich nahezu alle Tonschöpfer bedienten. Allein die Ausschmückung einer Melodie bei ihrer Wiederholung folgt bereits diesem Prinzip. Da es Variationen in allen Formen und Gattungen der Musik gibt, haben sie wahrscheinlich ihren Ursprung im menschlichen Spieltrieb. Wird ein musikalisches Thema "verändert" so spricht man von melodischen-, harmonischen- oder rhythmischen Variationen. Zwei Typen haben sich im Laufe der Zeit besonders etabliert: die Charakter- und die Figuralvariation. In den VARIATIONEN FÜR BLÄSERQUINTETT von Gottfried Veit erscheint das prägnante Thema von Niccoló Paganini (1782 – 1840) in fünf verschiedenen Gestalten. Jede Variation ist einem der Instrumente zugedacht. Es beginnt mit einer virtuosen Variation der Klarinette, geht mit einer beschwörenden Melodie der Oboe weiter, bringt dann heitere Kapriolen der Querflöte an die sich eine elegische Kantilene des Hornes anschließt. Zum Abschluss spielt das Fagott noch witzige Figuren als fünfte und letzte Variation. Diese Variationenreihe wird von einer kurzen Einleitung und einem bewegten Finale eingerahmt. Dass vor der ersten Variation das Thema in seiner Urgestalt erklingt, entspricht einer tradierten Gepflogenheit. Die "Variationen für Bläserquintett" von Gottfried Veit entstanden als Auftragskomposition des "Südtiroler Künstlerbundes" und wurden am 5. Juli 2002 - anlässlich des IGEB-Kongresses - in Lana vom Bläserquintett "Classix Quintitas" uraufgeführt. Verlag: Tatzer Musikverlag Schwierigkeitsgrad: Mittel Schwer/Schwer |
Tatzer Musikverlag | |

Vier romantische Lieder (1999)
Für mittlere Singstimme und Klavier
Text: Anton von Lutterotti Nachtlied, Was aber bliebe, Wintersonnwend, Kleiner Apfel 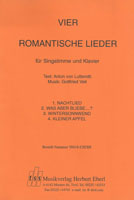
E. T. A. Hoffmann hat im Jahre 1810 als erster von romantischer Musik gesprochen, indem er die Musik "die romantischste aller Künste" nannte. Als "Musik der Romantik" (der Begriff Romantik wird vom altfranzösischen "romance", Dichtung, Roman, abgeleitet) wird jene Tonkunst bezeichnet, die im 19. Jahrhundert vorherrschte. Eines der signifikantesten Merkmale dieser Musik ist die Betonung des gefühlvollen Ausdruckes. Natürlich handelt es sich bei den "Vier romantischen Liedern" von Gottfried Veit nur um eine stilistische Nachempfindung dieser Tonkunst, da sie erst im Jahre 1999 entstanden. Der Text zu diesen "Kunstliedern", wie man Klavierlieder nicht selten bezeichnet, stammt von Anton von Lutterotti, der beruflich als Primar im Bozner Krankenhaus wirkte. Viele seiner Gedichte besitzen eine so starke Nähe zur Musik, sodass es fast ein Muss ist, sie zu vertonen. Er hat es immer wieder verstanden mit einfachen Worten tiefempfundene Gefühle auszudrücken. Das "Nachtlied" berichtet von der Geborgenheit in Gott, wenn es zum Ausdruck bringt: "lass uns ganz von Dir umgeben, friedlich ruhn in Deinem Arm!" Das Lied "Was aber bliebe" schildert hingegen mit großer Geste von den Errungenschaften der Welt, schließt aber mit dem bescheidenen Gedanken: "Was aber bliebe, hätten wir alles und nur die Liebe hätten wir nicht?" Die "Wintersonnwend", also das dritte Lied dieser Reihe, ist voll von Zuversicht, da es uns mit folgendem Gedanken wachrüttelt: "doch siegt die Hoffnung, denn nach Tagen der Dunkelheit folgt immer Licht!" Und schließlich das dreistrophige Gedicht "Kleiner Apfel". Es erzählt eine kindliche Geschichte und endet mit den Worten "hol ihn, hol ihn und sieh, wie süß er ist!". Uraufgeführt wurden diese vier Klavierlieder von Gottfried Veit am 25. Mai 1993 im Stadttheater von Meran. Die Interpreten waren dabei Fonso Willeit (Bariton) und Ulrike Ceresara (Klavier). Verlag: Tss Musikverlag Schwierigkeitsgrad: Leicht/Mittel Spieldauer: 12´30´´ |
Tss Musikverlag | |

Vier Südtiroler Volkslieder (1997)
In einfachen Sätzen für Oberchor
Juche Tirolerbua, Wia machens denn die Bauern, S` Bettelweibele, Wiegenlied 
Dass die Südtiroler ein singfreudiges Volk sind beweist einmal mehr das dreibändige Werk von Dr. Alfred Quellmalz mit dem Titel "Südtiroler Volkslieder". Diese umfangreiche Sammlung entstand gegen Ende der dreißiger Jahre des letzten Jahrhunderts und wurde 1968 vom Bärenreiter-Verlag veröffentlicht. Der Südtiroler Komponist Gottfried Veit, der sich Zeit seines Lebens mit dem Volkslied im Allgemeinen und den Südtiroler Volkslied im Besonderen beschäftigte (er studierte u. a. am Salzburger Mozarteum bei Prof. Cesar Bresgen das Fach "Volksliedkunde"), hat hier vier mehr oder weniger bekannte Volkslieder aus Südtirol in einfachen dreistimmigen Sätzen für Oberchor (SSA) vorgelegt, die als "Lieder-Suite" oder auch einzeln dargeboten werden können. Dieses kleine Kompendium besteht aus folgenden Liedern: a) "Juche Tirolerbua" (aus dem Pustertal) b) "Wia machens denn die Bauern" (aus Natz bei Brixen) c) "S’Bettlweibele" (aus Reinswald im Sarntal) d) "Wiegenlied" (aus Eppan) Verlag: Tss Musikverlag Schwierigkeitsgrad: Mittel Schwer Spieldauer: 10´05´´ |
Tss Musikverlag | |

Vier Südtiroler Volkslieder (1997)
In einfachen Sätzen für gemischten Chor
Mir wölln a Liedl stimmen an, Drunten ban Pseirergrabn, Wiegenlied; Die erst´n drei Tanzlen 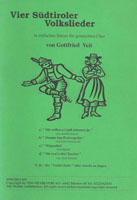
Dass die Südtiroler ein singfreudiges Volk sind beweist einmal mehr das dreibändige Werk von Dr. Alfred Quellmalz mit dem Titel "Südtiroler Volkslieder". Diese umfangreiche Sammlung entstand gegen Ende der dreißiger Jahre des letzten Jahrhunderts und wurde 1968 vom Bärenreiter-Verlag veröffentlicht. Der Südtiroler Komponist Gottfried Veit, der sich Zeit seines Lebens mit dem Volkslied im Allgemeinen und den Südtiroler Volkslied im Besonderen beschäftigte (er studierte u. a. am Salzburger Mozarteum bei Prof. Cesar Bresgen das Fach "Volksliedkunde"), hat hier vier mehr oder weniger bekannte Volkslieder aus Südtirol in einfachen vierstimmigen Sätzen für gemischten Chor (SATB) vorgelegt, die als "Lieder-Suite" oder auch einzeln dargeboten werden können. Dieses kleine Kompendium besteht aus folgenden Liedern: a) "Mir wöllen a Liadl stimmen an" (aus dem Weitental) b) "Druntn ban Pseiergrabn" (aus dem Passeiertal) c) "Wiegenlied" (aus Eppan) d) "Die erst’n drei Tanzlen" (aus dem Sarntal) Verlag: Tss Musikverlag Schwierigkeitsgrad: Mittel Schwer Spieldauer: 10´20´´ |
Tss Musikverlag | |

Weihnacht in Südtirol (2004)
16 Volkslieder in Sätzen für gemischten Chor
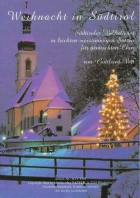
Keine Zeit im Jahreskreis hat so viele Liedschöpfungen hervor gebracht, wie die Weihnachtszeit. Weihnachten ist ohne Zweifel "Das Fest der Feste", wenngleich die Geburt Christi in den verschiedenen Ländern auch ganz unterschiedlich gefeiert wird. Eine Besonderheit ist es aber allemal, die weihnachtliche Zeit im Alpenland mitzuerleben. In diesem Kulturraum wurde bereits seit Menschengedenken außergewöhnlich viel musiziert. Die Pflege des bodenständigen Kulturgutes ist wohl ein unverkennbarer Ausdruck der Bewohner des Alpenlandes. Kein Wunder also, wenn sogar das kleine Land Südtirol über einen fast unüberschaubaren weihnachtlichen Liedschatz verfügt. Dieses klingende Kulturgut beinhaltet Adventslieder, Verkündigungslieder, Lieder zur Herbergssuche, Lieder zur Geburt Christi, Krippenlieder, Hirtenlieder, geistliche Wiegenlieder u. a. m. Alle haben aber eines gemeinsam: sie besingen das wunderbare Geschehen der Weihnacht. Die sechzehn in dieser Sammlung vorliegenden weihnachtlichen Volkslieder aus Südtirol stammen sowohl aus den Hauptorten als auch aus den entlegendsten Bergdörfern dieser traditionsreichen Landschaft. Die vierstimmigen Sätze für gemischten Chor wurden bewusst schlicht und einfach gehalten, um einerseits den Volkston zu bewahren und andererseits den leistungsschwächeren Chören entgegenzukommen. Die Tonsprache dieser Liedsätze entspricht also weitgehend den tradierten Singgewohnheiten. Möge dieses kleine Kompendium weihnachtlicher Volkslieder aus Südtirol viele Herzen nicht nur erreichen, sondern sie auch mit Freude erfüllen. Verlag: Tatzer Musikverlag Schwierigkeitsgrad: Mittel Schwer |
Tatzer Musikverlag |
